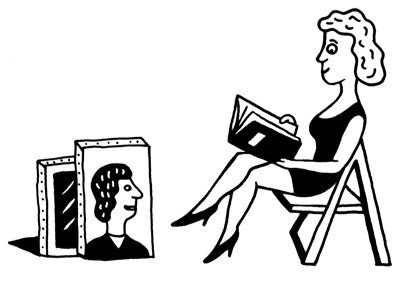Das Bild der Landschaft
Warum mögen wir eigentlich künstlerische Landschaftsdarstellungen, wenn es doch auch reichen würde, aus dem Fenster zu schauen oder an den Stadtrand zu fahren? Die Frage hätten sich die Menschen vor der Renaissance wohl auch gestellt, denn heute gilt Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux am 26. April 1336, die dieser in seiner gleichnamigen Abhandlung schilderte, als die erste emotional aufgeladene Landschaftsbetrachtung. Sie wird als Beginn des modernen Naturgefühls gewertet. Petrarca zeigte sich bei Erreichen des Gipfels überwältigt von der Schönheit der Welt, die sich vor ihm ausbreitet...
Er war demnach der Erste, der die Landschaft aus rein ästhetischen Gründen betrachtete, d. h. er stieg weder aus militärstrategischen Motiven auf einen Berg, noch weil es der kürzeste Weg zu einem angestrebten Ziel gewesen wäre, sondern ausschließlich, um den Fernblick zu genießen und ihn ohne konkrete Absichten in der Landschaft schweifen zu lassen.
Um solchen Genuss auch durch die Bildende Kunst zu ermöglichen, bedurfte es aber erst der durch Brunelleschi (1377 – 1446) und andere entdeckten Linearperspektive, mittels der es gelang, den dreidimensionalen Raum einer Landschaft auf der Bildebene darzustellen. Die früheren Möglichkeiten der Malerei hatten nicht ausgereicht, um mit Landschaftsbildern Gefühle auszulösen.
Der italienische Humanist Leon Battista Alberti (1404 –1472) analysierte 1452, dass der Anblick von Natur und von Naturbildern entspannend auf die Seele wirke, Harmonie erschaffe und den Einklang mit der kosmischen Ordnung bekunde. Von dem ihm nachfolgenden italienischen Künstler und Kunsthistoriker Giorgio Vasari (1511 – 1574) wissen wir, dass Naturbilder im 16. Jhd. den Menschen eine solche Freude bereiteten, dass sie zur Massenware für die bürgerlichen Schichten in den Städten geworden waren.
Hier ging es natürlich immer um weitgehend idealisierte Landschaften und dazu solche, die sich der normale Renaissancebürger nicht durch Reisen erschließen konnte. Erst im frühen 19. Jahrhundert zeigte sich bei Malern in England, Deutschland und Frankreich ein verstärktes Interesse an einer realistischen Landschaftsdarstellung, z.B. bei Adolph Menzel, der als einer der Ersten Industrielandschaften malte, oder bei Gustave Courbet, der auch Abstoßendes und Hässliches in seinen Bildern nicht aussparte.
Im Impressionismus wird die Malerei leicht und luftig, bestimmt von den Spielen des Lichts auf der Natur. Man malt nun nicht mehr nur im Atelier, sondern geht hinaus ins Freie, um sich beim Malen direkt den Eindrücken der Umgebung auszusetzen. Die Wahrnehmung der Dinge wird wichtiger als ihre Bedeutung. Wohl bekanntester Vertreter dieser Art von Malerei ist Claude Monet.
Im Expressionismus spielt die Landschaft eine nachgeordnete Rolle, der Mensch steht im Mittelpunkt der Kunst. An die Stelle der Licht- und Farbenspiele der Impressionisten treten menschliche Gefühle, die mit Hilfe der Landschaft ausgedrückt werden sollen. Die Landschaft fungiert nunmehr als Begleiterscheinung menschlichen Geschehens und bringt vielfach die Stimmung (die „innere Landschaft“) des Künstlers zum Ausdruck.
In der zeitgenössischen Kunst existieren alle Schattierungen von Landschaftsdarstellungen nebeneinander. Ziel ist es, beim Betrachten landschaftlicher Stimmungen innere Stimmungen in uns wachzurufen. Farben und Formen bewegen unser Gemüt und rufen in uns Lust- oder Unlustgefühle hervor. Sie erinnern uns an bestimmte Situationen. An bestimmte Orte. Oder aktivieren Sehnsüchte.